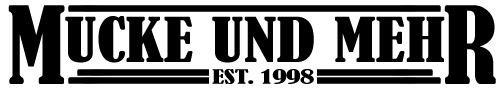The Cure
“Songs Of A Lost World”
(CD, Fiction Records, 2024)
Dass die Goth-Wave-Rock-Legenden von The Cure in den 45 Jahren seit Erscheinen ihres Debütalbums “Three Imaginary Boys” (1979) nie aufgehört haben, Musik zu machen, das haben die Mannen um Robert Smith in den letzten Jahren immer wieder mit Touren und Festival-Auftritten untermauert. Dass nun aber mit “Songs Of A Lost World” nach langen 16 Jahren endlich mal wieder ein neues Studioalbum vorliegt, das hat schon für extrem viel Aufmerksamkeit gesorgt, nicht nur unter den zahlreichen Fans, sondern in der ganzen Musikszene.
Mit der letzten Scheibe “4:13 Dream” war es 2008 wie schon mit denen davor, sie ließ sich durchaus gut anhören, an alte Klasse der Anfänge oder an den großartigen Meilenstein “Disintegration” aus dem Jahr 1989 kamen die Longplayer aber beileibe nicht heran. Umso schöner ist es doch, wenn dies nun tatsächlich gelingt und man sich in puncto Atmosphäre und Ergriffenheit endlich wieder voll aufgesaugt fühlt – ja, “Songs Of A Lost World” ist das beste The-Cure-Album seit “Disintegration” und knüpft weit mehr an dieses an, als es “Bloodflowers” im Jahr 2000 gelang, das als Abschluss einer mit “Pornography” 1982 gestarteten und dann mit “Disintegration” fortgesetzten Trilogie vermarktet wurde.

(© Universal Music)
Da unsere Rezension zu “Songs Of A Lost World” mit etwas Verspätung erscheint, können wir bereits berichten, dass The Cure hiermit in der britischen Heimat nicht nur das fünft-erfolgreichste Album des Jahres 2024 nach Taylor Swift, Coldplay, Sabrina Carpenter und Billie Eilish geglückt ist, sondern auch ihre erste Nummer 1 nach “Wish” vor 32 Jahren. Und nicht nur dort sind die Massen elektrisiert, in Deutschland stieg die Scheibe direkt auf Platz 1 ein und beschert der Band somit ihre erste Chartspitze überhaupt.
Acht Songs sind zu hören, und wer The Cure kennt, der weiß, dass die verhältnismäßig moderate Menge kein kurzes Album bedeuten muss. So ist es dann auch, werden wir doch fast 50 Minuten lang mit in die von Melancholie und Schönheit geprägte, klanglich so eigene Welt der Band genommen. Den Opener “Alone” boten Robert Smith (Gesang, Gitarre, Bass, Keyboard), Simon Gallup (Bass), Rodger O’Donnell (Keyboard), Reeves Gabrels (Gitarre) und Jason Cooper (Drums, Percussion) bereits vorab als Single mit Lyric-Video, und die im langsamen Midtempo dahin fließende, schöne, fast sieben Minuten lange Nummer legt das atmosphärische Fundament für die gesamte Scheibe. Über Keyboardflächen entwickeln sich erst einmal effektbehangene Gitarrenwirbeleien mit akzentuiert gesetztem Schlagzeug, bevor Robert Smith nach fast dreieinhalb Minuten mit “This is the end of every song that we sing” einsetzt – wobei das Album noch kein Ende bedeuten soll, wie man hört, was beruhigend ist.
Auch einige andere Stücke sind nicht ganz neu, spielten The Cure doch eine Auswahl bereits während ihrer 90-tägigen “Shows Of A Lost World”-Tour durch 33 Ländern vor mehr als 1,3 Millionen Zuschauern. Hierzu gehörte auch das mit Piano und elektronischen Streichern eröffnende, ebenfalls fast sieben Minuten lange “And Nothing Is Forever”, bei dem sich nach einer Weile erst eine knarzige E-Gitarre dazu gesellt, dann im langsamen Midtempo angesiedelte Drums und bereits viel Schönheit ins Ohr wandert, bevor Smith nach etwas mehr als zweieinhalb Minuten einsetzt und seine Hoffnung ausdrückt, immer mit dem Partner zusammen zu bleiben, für immer und ganz egal, ob auch mal schwierige Zeiten kommen.
Die nächsten drei Songs sind mit unter fünf Minuten die kürzesten des Albums, aber nicht weniger packend. Die tiefe Basslinie des im Tempo etwas angezogenen “A Fragile Thing” und der traurige Text über eine tiefe, nicht anhaltende Liebe gehen unter die Haut – hier in einer Live-Performance bei der BBC zu bewundern:
Der “Warsong” ist passend zum Thema kein angenehmer und bietet progressive Verstörung, bei der die Zeilen “No way out of this, no way for us to find a way to peace” wenig Hoffnung schürt – wenn man auf das aktuelle Weltgeschehen blickt ja leider irgendwie sehr passend. “Drone:Nodrone” schließt treibend und energetisch an mit einer flirrenden E-Gitarren-Linie zu einem wenig optimistischen Text über ausweglos erscheinende Gefühle.
Am Anfang des Sechsminüters “I Can Never Say Goodbye” gewittert es wie einst in “The Same Deep Water As You” auf “Disintegration” und hiermit wird es wieder getragen und melancholisch schön, zu einem erneut niedergeschlagenen Text, bei dem das Erwehren gegen die Dunkelheit und bösen Zauber nicht zu helfen vermag.
Mit dem fünfeinhalb Minuten langen “All I Ever Am” folgt noch ein etwas flotteres und energiegeladeneres Stück darüber, dass man manchmal vielleicht zu viel zweifelt, ob die gefundene Liebe denn nie ausreicht oder wohin die Reise des Lebens gehen möge, womit man viel zu viel desselben vergeudet.
Den Abschluss bildet mit “Endsong” ein wahres Gemälde von Lied, über zehn Minuten lang dahin fließend, nie langweilig werdend und einfach nur schön – auch wenn am Ende mit “Left alone with nothing at the end of every song” erneut wenig Erquickendes resümiert wird. Aber so kennen wir The Cure ja, und so lieben wir sie. Ein endlich mal wieder begeisterndes Album, das im direkten Vergleich zu “Disintegration”, das mit “Lovesong” auch ein fröhliches Liebeslied aufbot, aber auch sonst kaum zu toppen ist, nur knapp den Kürzeren zieht. Ein überraschend starker, trotz nicht oft Optimismus ausstrahlender Texte glücklich machender Longplayer, zu dem man sich das dreistündige, umwerfende Release-Konzert im Netz anschauen kann:
www.thecure.com
facebook.com/thecure
instagram.com/thecure
Bewertung: 9 von 10 Punkten
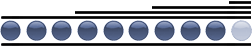
(MUCKE UND MEHR ist Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon EU, das zur Bereitstellung eines Mediums für Websites konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Werbeanzeigen und Links zu Amazon.de Werbekostenerstattung verdient werden kann.)