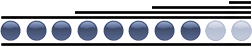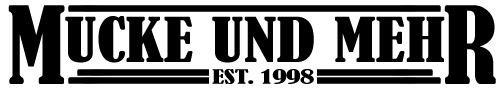Oppenheimer
Darsteller: Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr.
Regie: Christopher Nolan
Dauer: 180 Minuten
FSK: freigegeben ab 12 Jahren
Website: oppenheimer-film.de
Facebook: facebook.com/OppenheimerFilmDE
Die PR-Maschine läuft schon seit einiger Zeit auf Hochtouren für Christopher Nolans („Inception“, „Tenet“) „Oppenheimer“ und steigert unsere Spannung auf sein Biopic über den Vorreiter der Quantenphysik Robert Oppenheimer, der als „Vater der Atombombe“ in die Geschichte einging, enorm. Ähnlich wie das zweite rotglühende Eisen im Kultregisseurfeuer Wes Anderson, der in seinem „Asteroid City“ vor Kurzem ein beachtliches Starensemble aufbot, konnte sich hier auch Christopher Nolan bei der Besetzung fast nach Belieben aus dem Pool der renommiertesten Schauspieler:innen bedienen, die für sein Projekt auf große Teile ihrer dem Marktwert entsprechenden Gagen verzichteten. Dementsprechend hoch ist selbstverständlich die Vorfreude und Erwartungshaltung an seinen Film, für den er eigens Kai Birds und Martin J. Sherwins Biografie über den berühmten Physiker für die Leinwand umgeschrieben hat.
Und der beeindruckt zunächst einmal mit der Wucht seines 70mm-Formats, auch wenn er erstmal wie ein handelsübliches Historienstück anmutet, das uns fast chronologisch, wenn auch mit einigen verschränkten Zeitebenen, durch den Werdegang Oppenheimers (Cillian Murphy) geleitet. Natürlich ist das ungemein lehrreich und schafft eine wichtige Basis für das Verständnis des folgenden Geschehens, aber Nolan, der uns in seinen früheren Werken oft mit seinen sensationellen Bildkompositionen und fast absurden Gedankenspielen fasziniert hat, enttäuscht mit seiner konservativen Herangehensweise an die Vita des Atomphysikers doch ein wenig. Trotzdem zaubert er auch in diesen ersten anderthalb (!!!) Stunden seines etwas behäbig in die Gänge kommenden Dreistünders wieder etwas überraschend Experimentelles aus dem Hut, kombiniert die verschiedenen Zeitebenen des Lebenslaufs Oppenheimers mit regelmäßig eingeschnittenen analogen Schwarz-Weiß-Sequenzen einer sich aufbauenden Intrige des Leiters der amerikanischen Atomenergiebehörde Lewis Strauss (Robert Downey Jr.), deren politische Relevanz sich uns erst später komplett erschließen soll.
Erstmal aber begleiten wir den physikalischen Genius auf seinem Weg zum Führer des „Manhattan-Projekts“, das die USA während des Zweiten Weltkriegs unter dem Druck ähnlicher deutscher und sowjetischer Bestrebungen ins Leben riefen um in der Wüste New Mexicos die Entwicklung der Atombombe zu forcieren, und das letztendlich zwei Milliarden Dollar verschlingen sollte. Also wer, wenn nicht der international bestens vernetzte Oppenheimer, der mit seinen revolutionären Theorien und Berechnungen zum Verhalten von Atomen nicht nur seine Studenten sondern seit Jahren auch Physikerkollegen in aller Welt inspiriert, wäre besser geeignet, dieses Ziel mit Hochdruck zu verfolgen? Das muss dann auch der militärische Projektleiter General Leslie R. Groves – in schönem Kontrast zum nachdenklichen Oppenheimer wunderbar hemdsärmelig von Matt Damon gespielt – einsehen, der ihn trotz dessen kommunistischer Umtriebe an der Uni verpflichtet.

(© Universal Studios. All Rights Reserved.)
Ein erster Einschnitt sowohl im Leben Oppenheimers als auch in Nolans Drama, ist sich Oppenheimer doch mit Eintritt bewusst, was dieses konkrete Ziel seiner Forschungen zur Kernspaltung für die Menschheit bedeutet, nicht umsonst zieht Nolan schon durch Einblendungen im Vorspann Parallelen zum mythischen Titanen Prometheus, der den Menschen einst die Macht über das Feuer gab. Und wie eindrücklich lässt uns hier Cillian Murphy mit nahezu unerschütterlicher finsterer Miene an der Zerrissenheit seines Robert Oppenheimer teilhaben, die Nolan in der Stunde des größten Triumphs, dem erfolgreichen Atomtest im Juli 1945, kulminieren lässt. Es ist diese beeindruckende Sequenz, die noch am ehesten an die Intensität seiner früheren Filme heranreicht und die uns mit bombastischem Getöse und den verbrannten Leibern von Bombenopfern im gleißenden Licht während der Siegesrede Oppenheimers eine Vorstellung vom inneren Kampf des Wissenschaftlers gibt.
Dieser Höhepunkt leitet die packendste Phase des Streifens ein, visualisiert Nolan darin die Ängste des Physikers, mit seinem kriegsbeendenden Werk, den Bombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki, ein teuflisches Werkzeug für die Zerstörung der Menschheit geschaffen zu haben. Ein nicht so fernliegender Gedanke, den das epische Werk in seine zweite Hälfte trägt, die Oppenheimer durchaus spannend in die Mühlen politischer Polemik in der McCarthy-Ära des Kalten Krieges geraten lässt, sich dabei aber ein wenig in den Wirren der Verhöre verliert. Dennoch ist Nolans etwas zu lang geratenes Biopic über einen der bedeutendsten Wissenschaftler der Geschichte ein überaus sehenswertes, emotionales Lehrstück mit allerhand Denkanstößen, Erwartungshaltung hin oder her.
Trailer:
Bewertung: 8 von 10 Punkten